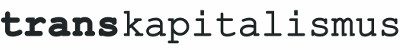Es war einmal ein Märchen, das handelte vom Schlaraffenland. Noch in den 1970er Jahren lernten Kinder es in Erzählungen der Großeltern kennen. In den Shopping-Zonen der Metropolen ist es für einige wahr geworden. Erdbeeren aus Südafrika im Winter, Lammfleisch aus Neuseeland, Kleidung aus Tunesien, Smartphones aus Korea und Kalifornien und vieles mehr. Rund um den Globus werden heute Produkte in einer Menge transportiert und verkauft, die noch vor 40 Jahren unvorstellbar war. Die damals einsetzende Globalisierung entfesselte den Welthandel. Sie hat das »Güternet« der Container hervorgebracht, das Warenpakete transportiert, und das Internet der Computer, das Datenpakete um die Welt schickt.
Die Globalisierung wird oft als recht neues Phänomen beschrieben, aber ihr Ursprung liegt weit zurück. Einen ersten Anlauf nahm sie im Zeitalter des Kolonialismus, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges brach sie ab. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollte die Entwicklung wieder aufgegriffen werden. 1947 schlossen 23 Länder das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen Gatt. Handel, so die Idee dahinter, verbinde Nationen und mehre ihren Wohlstand, auf dass sie nicht mehr mit dem Gedanken an Krieg spielen.
In acht Handelsrunden wurde das Gatt immer feiner ausgearbeitet, stießen immer mehr Länder dazu. Von 1948 bis 1995 verhundertfachte sich das globale Handelsvolumen. Dieses Wachstum sollte die Welthandelsorganisation WTO, die am 1. Januar 1995 in Genf ihre Arbeit aufnahm und heute 162 Mitgliedstaaten zählt, noch ausweiten. Der Welthandel vervierfachte sich noch einmal, auf knapp 24 Billionen Dollar im Jahr 2014, Dienstleistungen eingeschlossen.
Doch das neue Schlaraffenland hat dunkle Hinterhöfe. Neue Kriege, wachsende Ungleichheit, zunehmende Migration und eine globale Finanzkrise hat das Handelswunder nicht verhindern können. Die Unzufriedenheit des Globalen Südens ließ die neunte Welthandelsrunde, die sogenannte Doha-Runde, 2008 ohne Ergebnis in sich zusammensacken.
Auch in den alten Industrieländern hat sich zuletzt heftiger Protest gegen neue Handelsabkommen wie TPP oder TTIP geregt. Der Welthandel selbst wuchs seit 2012 nur noch um magere 2,5 Prozent jährlich, kein Vergleich zu den Boomjahren vor dem Finanzcrash. Business as usual funktioniert nicht mehr. Wie geht es weiter? Wie sollte es weitergehen?
Szenario 1: Globaler Freihandel
Wer im Internet Produkte aus anderen Weltgegenden kauft, bekommt mitunter Post vom Zoll. Das Paket wartet im Zollamt und wird erst dann herausgerückt, wenn der Empfänger die Einfuhrumsatzsteuer und einen Zollsatz von einigen Prozent bezahlt hat. In einer Welt, wie er den klassischen Liberalen vorschwet, gäbe es diese Prozedur nicht mehr: Dann würde globaler Freihandel herrschen. Jeder dürfte Produkte überallhin verkaufen und von überall kaufen. Die Staaten könnten ihre Zollbehörden abschaffen.
Das wäre für manche besser als der Status quo. Ein solches Handelsregime würde zum Beispiel auch Unternehmern in Kenia nützen. Sie könnten aus dem Kakao, der dort angebaut wird, Schokolade herstellen und direkt nach Europa verkaufen. Bislang geht das nicht: Die Einfuhr ist nur für Kakao als Rohstoff frei, nicht jedoch für daraus verarbeitete Produkte. Wenn die kenianische Tafel Schokolade lecker und günstig zugleich ist, könnten die Hersteller den hiesigen Schokofabrikanten das Geschäft streitig machen. Diese könnten im Extremfall pleitegehen, so dass am Ende in den Supermarktregalen nur noch Schokolade aus afrikanischen Ländern stünde.
Für die Weltwirtschaft insgesamt wäre ein solches Szenario gut, argumentierte der Begründer der Freihandelstheorie, der Engländer David Ricardo, schon vor 200 Jahren. Nach seiner Theorie des komparativen Kostenvorteils führt Freihandel dazu, dass sich jedes Land auf das spezialisiert, was es am effektivsten herstellen kann: Kenia beispielsweise Schokolade, während Deutschland sich etwa noch mehr auf Maschinen konzentrierte. Ricardo rechnete vor, dass bei einer solchen Arbeitsteilung zwischen zwei Ländern unter dem Strich nicht nur mehr produziert wird als vor einem Freihandel, sondern beide Länder auch besser dastehen als vorher. Nun war Ricardos Modell noch sehr simpel und abstrakt. Ökonomen späterer Generationen verfeinerten es, vor allem die Schweden Bertil Ohlin und Eli Heckscher um 1930 und der Amerikaner Paul Krugman mit seiner Neuen Ökonomischen Geographie 1991 (er wurde 2008 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet). An der Konsequenz, die Ricardo formuliert hatte, änderte sich jedoch nichts.
Zahlreiche Modellrechnungen, die in den vergangenen Jahren verschiedene Handelsszenarien verglichen haben, zeigen: Beim globalen Freihandel stiege das volkswirtschaftliche Einkommen am stärksten, in vielen Studien sogar für alle Beteiligten. Die OECD sagte 2006 einen globalen Einkommenszuwachs von 287 Milliarden Dollar bis 2015 vorher. Eine Studie der Carnegie Endowment for International Peace, die zur gleichen Zeit die Zukunftsaussichten für Entwicklungs- und Schwellenländer modellierte, kam auf 168 Milliarden Dollar. Auch hier schnitt kein Szenario, bei dem es noch irgendeine Form von Handelsbarrieren gab, besser ab. Zum Vergleich: Die Vorschläge, die damals in den WTO-Verhandlungen in Doha auf dem Tisch lagen, hätten nur einen Zuwachs von knapp 59 Milliarden Dollar gebracht. Der Praxistest blieb jedoch aus – die Doha-Runde scheiterte.
Den Modellen liegt ein »rechenbares allgemeines Gleichgewicht« (CGE) zugrunde, so der ökonomische Fachbegriff. Das Problem dabei sind einige realitätsferne Annahmen: Vollbeschäftigung, der flexible Wechsel von Arbeitnehmern von einer Branche in eine andere, die Zweiteilung der Arbeitnehmerschaft in gelernte und ungelernte Arbeiter, unabhängig vom Wirtschaftssektor. Das Carnegie-Modell unterschied immerhin erstmals zwischen ungelernten Arbeitern in Industrie und in Landwirtschaft.
Der errechnete Einkommenszuwachs durch globalen Freihandel sagt aber nichts darüber aus, wie er in einem Land verteilt wird. Und: »Die Modelle konzentrieren sich in der Regel auf tarifäre Handelshemmnisse wie Zölle«, sagt Christian Dreger, Forschungsdirektor Internationale Ökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW. »Nicht tarifäre Handelshemmnisse« wie Standards bei Arbeits- oder Umweltschutz ließen sich weitaus schwerer quantifizieren.
Dass ein globaler Freihandel besser wäre als das jetzige Welthandelssystem, in dem etwa die EU bei Lebensmitteln zulasten der Entwicklungsländer an Zöllen festhält, glauben die meisten. Dass ein globaler Freihandel kommen wird, glauben die wenigsten. Die unterschiedlichen Interessen von Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern machten dies in absehbarer Zukunft unmöglich, sagt Franziska Biermann, Außenhandelsexpertin beim Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut HWWI. »Zurzeit leider völlig unrealistisch«, urteilt Stormy Mildner, beim Bundesverband der Deutschen Industrie für Außenwirtschaftspolitik zuständig.
Szenario 2: Die Welt der Handelsblöcke
Am 1. Januar 1993 fielen in Europa offiziell die Handelsschranken, der Europäische Binnenmarkt war geöffnet. Was Europäern nur als logischer Schritt hin zur Heilung eines vernarbten Kontinents erschien, war die Geburt des ersten großen Handelsblocks der jüngeren Geschichte. Die nordamerikanische Nafta, der südamerikanische Mercosur, die südostasiatische Afta folgten. Mit dem Abbruch der Doha-Runde der WTO schnellte die Zahl weiterer Handelsabkommen zwischen Staaten rasant in die Hunderte. Prominentester Neuzugang: die am 4. Februar 2016 in Auckland unterzeichnete Transpazifische Partnerschaft TPP, an der die USA und elf weitere Pazifikstaaten beteiligt sind.
Weitere große Handelsblöcke sind geplant: die transatlantische TTIP aus EU und USA sowie die Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, in der unter anderem China und Indien sich austauschen. Der Flickenteppich aus Handelsabkommen wird von Jahr zu Jahr unüberschaubarer. »Für die meisten Länder des Südens ist dies das Worst-Case-Szenario«, sagt Clara Brandi, Ökonomin am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. »Die afrikanischen Länder zum Beispiel sind bei den drei großen Abkommen – TPP, TTIP, RCEP – nicht mit dabei, während dort die Handelsregeln der Zukunft geschrieben werden.« Fast könnte man meinen, die ökonomischen Schwergewichte des Planeten wären beleidigt gewesen, als der Süden die WTO-Verhandlungen über neue globale Regeln 2008 ins Stocken brachte.
Das Problem an sogenannten bilateralen oder regionalen Freihandelsabkommen ist, dass sie mehr Verlierer hervorbringen könnten als andere Handelsszenarien. Während im Freihandel wenigstens im Prinzip alle auf dem gleichen Spielfeld nach denselben Regeln agieren, sind nun die Mitglieder eines Abkommens im Vergleich zu Nichtmitgliedern im Vorteil. Ihr Getreide, ihre Rohstoffe, ihre Textilien sind im neuen Block plötzlich billiger als die der Konkurrenz, deren Anteil am Handel in der Region abnimmt. Trade Diversion, »Handelsumlenkung«, nennen Ökonomen diesen Effekt. Eine weitere Folge: Importe aus Ländern des Abkommens werden bevorzugt behandelt. Eine im Januar veröffentlichte Studie der Weltbank erwartet für die TPP-Zone, dass in den kommenden zehn Jahren 40 Prozent der Textilien, aus denen Bekleidung hergestellt wird, durch Importe aus TPP-Ländern ersetzt werden.
Speziell bei TPP und TTIP haben sich auch prominente Ökonomen unter die Kritiker gemischt. »Bei dem Pazifik-Deal geht es eigentlich nicht um Handel«, sagt Paul Krugman, weil die Zölle der beteiligten Länder bereits sehr niedrig seien. Es gehe vornehmlich um den Schutz geistiger Eigentumsrechte und neue Möglichkeiten, mit denen Unternehmen und Staaten Handelsstreitigkeiten ausfechten können. Joseph Stiglitz wird noch deutlicher: Die Partnerländer wollten weniger neue Handelsmöglichkeiten schaffen als vielmehr »im Namen der mächtigsten Wirtschaftslobbys« Handel und Investitionen zu deren Vorteil managen. Die prognostizierten Wachstumsgewinne der großen Blöcke sind bescheiden: Seriöse Studien gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Blöcke in den kommenden zehn Jahren um zusätzliche 0,5 Prozent steigt.
Die Containerisierung des Welthandels hat maßgeblich geholfen, Produktionsketten über den ganzen Globus zu spannen. Da werden nicht nur Südfrüchte über die Weltmeere transportiert. In manchen Branchen gibt es bis zu 20 globalisierte Arbeitsschritte, deren Teilprodukte in Containern um die Welt fahren und künftig immer mehr Grenzen von Handelsabkommen passieren müssen.
»Das behindert auch die internationale Arbeitsteilung«, sagt DIW-Forscher Christian Dreger. Die Versuchung, dass sich jede Handelsnation selbst die Nächste ist, halten viele Ökonomen für groß.
Vielleicht ist die neue Welt der Handelsblöcke nur eine vorübergehende Phase des Welthandels. Der Ökonom Douglas Irwin hat darauf hingewiesen, dass es im 19. Jahrhundert schon einmal einen Flickenteppich aus einzelnen Handelsabkommen der europäischen Nationen gab. Der verdichtete sich irgendwann derart, dass ein umfassendes Netz aus Handelsbeziehungen entstand, »in dem der internationale Handel in eine liberale Ära trat, die es so noch nicht gegeben hatte«. Die Machtgelüste der europäischen Kolonialmächte hat dieses Netz nicht eindämmen können – es riss im August 2014 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, des weitgespanntesten und brutalsten militärischen Konflikts, den die Welt bis dahin gesehen hatte. Gibt es noch eine dritte Option?
Szenario 3: Globaler Fair Trade
Was die internationale Politik nicht schafft, versuchen seit einigen Jahren Organisationen und Bürgerinnen in den Industrieländern: einen fairen Handel in kleinen Schritten auf die Beine zu stellen. Immer mehr Fair-Trade-Produkte, von Kaffee bis zu T-Shirts, sind im Angebot. Bauern und Näherinnen in Entwicklungsländern sollen mehr Geld vom Endpreis abbekommen, ihre Arbeitsbedingungen besser werden. Das gelingt teilweise schon gut. Im gegenwärtigen Welthandel sind diese Projekte jedoch kaum wahrnehmbar. Wie also geht Fair Trade im globalen Maßstab? »Das weiß zurzeit noch niemand«, sagt Julius Sen, der an der London School of Economics zu Handelspolitik forscht.
Erfahrungen aus der Vergangenheit bieten aber Anhaltspunkte: Die Industrieländer könnten einseitig sämtliche Zölle für Produkte aus Entwicklungsländern auf null setzen, so wie es Großbritannien im 19. Jahrhundert tat, allerdings aus einer Position enormer wirtschaftlicher Stärke heraus. Die Länder des Globalen Südens hingegen dürften Handelsbarrieren aufrechterhalten.
Damit sind manche Länder in der Vergangenheit gut gefahren. Südkorea ist als eines der ersten früheren Schwellenländer zu einem Industrieland geworden. Als es seine Aufholjagd startete, hatte es nach der Freihandelstheorie seinen komparativen Kostenvorteil in der Landwirtschaft. Wäre es dieser Theorie gefolgt, wäre Südkorea heute einer der effizientesten Reisproduzenten der Welt.
Stattdessen »entwickelte Südkorea ein Programm einander ergänzender industrie-, bildungs- und technologiepolitischer Maßnahmen, mit dem es ihm gelang, das Pro-Kopf-Einkommen in weniger als vier Jahrzehnten auf mehr als das Achtfache zu erhöhen«, schreibt der Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Heute exportiert Südkorea Autos, Computer und Smartphones.
Ein anderes Beispiel: Während Vietnam hohe Zölle von bis zu 50 Prozent sowie Einfuhrquoten beibehielt, senkte Haiti seine Zölle auf 15 Prozent und beseitigte alle Einfuhrquoten im Sinne der WTO. Eines der beiden Länder kam wirtschaftlich nicht voran, das andere erzielte Wachstumsraten von jährlich acht Prozent.
Welches Land war das erfolgreichere? Vietnam. Für den aus der Türkei stammenden Harvard-Ökonomen Dani Rodrik lautet eine Lehre aus diesem Beispiel: »Integration in die Weltwirtschaft ist das Ergebnis und nicht die Voraussetzung einer erfolgreichen Wachstumsstrategie.« Klar ist für ihn aber auch: »Kein Land hat sich je erfolgreich entwickelt, indem es sich vor internationalem Handel verschloss.«
Ein globales Fair-Trade-System, in dem Entwicklung ein Hauptziel ist, muss andere Spielregeln haben als ein globales Freihandelssystem. Rodrik hat bereits im Jahr 2001 einige mögliche Regeln aufgestellt: Handel darf kein Selbstzweck sein, Handelsregeln müssen eine Vielfalt an Standards zulassen, undemokratische Regime bekommen keine Handelsvorteile zugestanden, Länder dürfen selbst über die Förderung einzelner Wirtschaftszweige entscheiden, kein Land darf einem anderen bestimmte Produkte aufzwingen.
Das passt auch zu den neuen Sustainable Development Goals der UN, die die Millenniumsziele 2015 abgelöst haben: »Ein allgemeines, regelbasiertes, offenes, nicht diskriminierendes und gleichberechtigtes multilaterales Handelssystem zu fördern«, heißt eines der Ziele – »im Rahmen der Welthandelsorganisation«.
Die WTO hält LSE-Forscher Julius Sen für das entscheidende Forum für ein gerechtes Handelssystem. Sie solle sich weniger darum bemühen, Märkte zu öffnen als Handelsregeln zu entwickeln. Zum Beispiel die Zollabfertigung international zu vereinheitlichen und zu vereinfachen: »Damit könnte die WTO einen enormen Beitrag leisten«, sagt Sen. Doch weder er noch andere Ökonomen glauben, dass dieses Szenario auf Jahre hinaus realistisch ist.
(nbo; eine Version dieses Textes erschien zuerst in ZEIT Wissen 3/2016)
Bild: Gerrit van Blaaderen, „Haven te Douarnenez“, ca. 1920, Public Domain